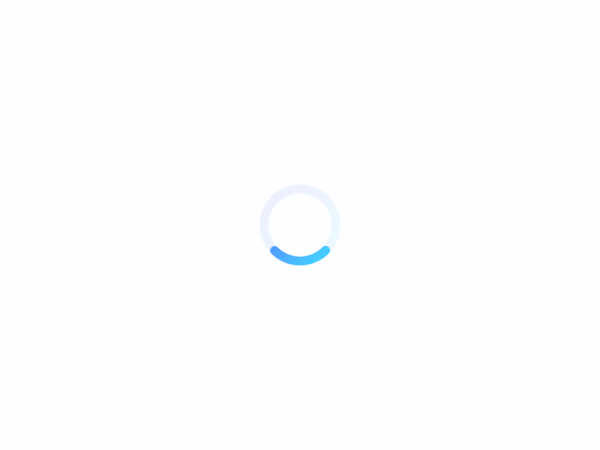LK 1070, 665 875/259 240. Höhe 364 m.
Datum der Ausgrabung: 19.4.-9.8.2010; Aushubbegleitung 1.9.-28.10.2010
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 93, 2010, 239f.244; A. Schaer, Die aktuellen Ausgrabungen im Badener Bäderquartier. Badener Neujahrsblätter 86, 2011, 169-177.
Notgrabung (Neubau Wohn- und Gewerbehaus). Grösse der Grabung 2010 ca. 400 m².
Siedlung/Hangbebauung.
In der Kampagne 2010 wurde primär der Bereich hangwärts der Grabung 2009 untersucht (Abb. 13). Beobachtungen bei der Aushubbegleitung im Herbst lieferten zusätzliche Hinweise zum Bebauungsmuster ausserhalb der untersuchten Fläche.
Nach maschinellen Vorabträgen lagen bald die Kronen der von der Ausgrabung 2009 bekannten Hangfallmauern frei, was die beachtlichen Dimensionen der gesamten Hangbebauung erschloss. Schon bald bestätigte sich, dass es sich bei der vorjährig beobachteten Kiesfläche tatsächlich um eine Strasse handelt. Sie verläuft rampenartig in der Hangfalllinie zwischen zwei Häuserzeilen. Offensichtlich verband sie das im Limmatknie gelegene Thermenareal mit dem höher gelegenen Vicusbereich auf dem Haselfeldplateau. Hangaufwärts öffnet sich die Strasse V-förmig. Dadurch entsteht eine perspektivisch bemerkenswerte Situation, die möglicherweise den Übergang zum Thermenbereich (dem Nukleus der Siedlung) baulich inszeniert. Wohl im Laufe des 2. Jh. wurde diese Zone mit einer spickelförmigen Raumgruppe mit Keller überbaut. Die Strasse wurde dabei wesentlich verschmälert, öffnet sich aber weiterhin leicht dem Hangfuss zu.
Über die Bebauung östlich der Strasse ist wenig bekannt. Im mittleren Hangbereich wurde ein gewölbtes Mauerstück (Viertelkreissegment) aus Handquadern freigelegt. Es dürfte sich dabei um Stützmauerwerk im Stil eines Entlastungsbogens handeln. Befunde vergleichbarer Art sind von der Stadtrandbebauung der Augster Oberstadt (Insula 39) bekannt.
Die Zone westlich der Rampe ist gekennzeichnet durch ein bisher zweiteiliges Gebäude im oberen Hangbereich. Die aktuelle Kampagne ergab hangabwärts anschliessend einen vollständig in den Sandstein geschroteten Raum mit rund 60 m² Grundfläche. Brandspuren am Boden der südwestlichen Raumecke könnten von einer eingestellten Holzkammer stammen. Das Gebäude selbst wird durch eine massive Stützmauer mit Ziegeldurchschuss im Westbereich abgeschlossen. Den grossflächigen Bereich unterhalb dieser Mauer möchte man zurzeit als aufgeschüttete Freizone/Terrasse deuten; entsprechende Hinweise hat hier das Grabungsrandprofil geliefert.
Ein präzises Chronologiegerüst des dokumentierten Siedlungsausschnittes bedarf noch einer eingehenden Materialdurchsicht. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass erste Gebäude hier noch vor der Mitte des 1. Jh. entstanden. Der etappenweise Ausbau der Anlage und zuletzt die Verjüngung der Strasse erfolgen wohl seit dem späteren 1. Jh. und hauptsächlich im Laufe des 2. Jh.
Die jüngsten Funde, darunter Trierer Spruchbecher aus dem Brandschutt eines Kellers mit Treppenabgang, zeigen, dass zumindest gewisse Teile der Hangbebauung noch über die Jahre um 260 hinaus regulär genutzt wurden. Spätrömische Befunde oder konkrete Hinweise auf eine Ruinenbewirtschaftung fehlen bisher. Bemerkenswert bleibt aber der signifikante Anstieg des Münzspiegels zum Ende des 4. Jh. hin. Dieses Bild entspricht den Beobachtungen bei der numismatischen Auswertung der zentralen Quelle von Aquae Helveticae (Grosser Heisser Stein) und muss im Rahmen der zukünftigen Analyse der Siedlungsgeschichte eingehender untersucht werden. Die freigelegten Befunde sind als «verdichtete Bauweise in Hanglange» zu subsumieren. Eine solche ist für städtische Randzonen bezeichnend und in Aquae Helveticae nun zu beiden Seiten der Limmat gleichermassen nachgewiesen.
Faunistisches Material: Tierknochen, Mollusken.
Probenentnahmen: Schlämmproben; Sedimentproben.
Datierung: archäologisch. 1.-3. Jh.
KA AG, St. Wyss.
 All chronicles
All chronicles
Baden AG, Dependance Ochsen
View the original PDF
Details of the chronicle
Municipality
Baden
Canton
AG
Location
Dependance Ochsen
Coordinates
E 2665875, N 1259240
Elevation
364 m
Site reference number
--
Cantonal intervention number
--
New site
--
Sampling
archaeobiological sample, geoarchaeological sediment sample
analyses
--
Discovery date
--
Surface (m²)
400 m2
Start date
19 April 2010
End date
28 October 2010
Dating method
archaeological
Publication year
2011
Period
Roman Era
Site type
settlement
Type of intervention
excavation (rescue excavation)
Archaeological finds
--
bones
animal bones (dispersed), other
Botanical material
--
×