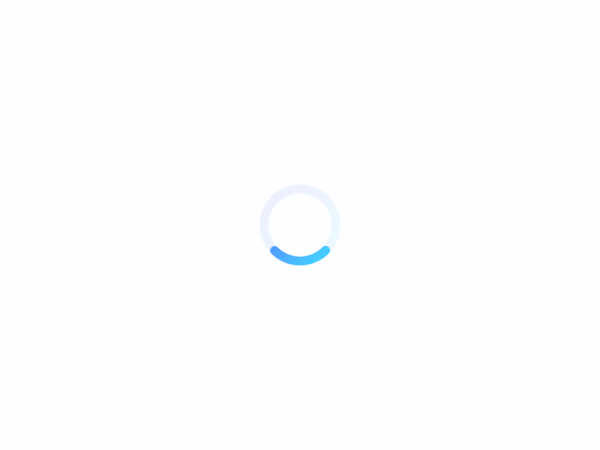Auf der östlichen Domleschger Talseite steht, an höchster Stelle des lang gezogenen Felsrückens, der die Siedlungsterrasse von der Rheintalebene trennt, von weither sichtbar die romanische Kirche Sogn Luregn. Das Gotteshaus, ein Saalbau mit rechteckigem, eingezogenem Chor, gehört mit einer Länge von 13 m und einer Breite von 6 m zu den kleineren Kirchenbauten Graubündens. Auffällig ist der Standort des Glockenturms, der an der Südseite steht und durch den man zum Eingangsportal in den Kirchenraum gelangt. Im Innern lassen die erhaltenen Wandpfeiler erkennen, dass die Kirche ursprünglich zweischiffig war und ein mehrteiliges Gewölbe trug (Bau 1), welches zu einem späteren Zeitpunkt einem Zerstörungsereignis anheimfiel oder absichtlich abgebrochen wurde. Bei der darauffolgenden Instandsetzung wurde auf dessen Wiederherstellung verzichtet, jedoch sowohl das Dach über dem Schiff als auch der ursprüngliche, mutmasslich halbrunde durch den heute noch bestehenden, rechteckigen Chor ersetzt (Bau 2).
Die Baugeschichte zu Sogn Luregn hat erstmals der Kunsthistoriker Johann Rudolf Rahn 1873 beschrieben. Erwin Poeschel ergänzte 1940, dass gleichzeitig mit dem Bau des neuen Altarraums der Turm errichtet worden sei. Die erste Kirche (Bau 1) datierte er typologisch ins 11. Jahrhundert, die Wiederherstellung mit dem Turm und Rechteckchor (Bau 2) anhand der Wandmalereien ins frühe 13. Jahrhundert. Diese Annahmen wurden 1957 während der im Rahmen der umfassenden Restaurierung der Kirche durchgeführten Ausgrabungen von Walther Sulser bestätigt. Ausserordentlich war seinerzeit die Entdeckung mehrerer Reliquienbehälter, die im Altar unter der Deckplatte aus Marmor (Mensa) eingemauert waren. Stilistische Merkmale datieren diese Reliquiare ins Frühmittelalter und damit deutlich früher als den Bau 1. Anhand von Gräbern unterhalb des Fundaments von Bau 1, die während der Ausgrabungen 1957 zum Vorschein kamen, schloss Sulser analog zu Poeschel auf eine dazu gehörende Urkirche, von der aber nichts mehr erhalten sei oder die andernorts gestanden habe. Zu diesem Friedhof, der vermutlich bis ins Frühmittelalter zurückgeht, muss jedoch nicht zwingend eine Kirche gehört haben. In Graubünden sind an verschiedenen Orten, z. B. in Zillis und Casti-Wergenstein, bis ins Hochmittelalter genutzte Begräbnisstätten ohne Gotteshaus nachgewiesen. Seit den bauarchäologischen Untersuchungen an der Kirchenanlage von Sogn Murezi im nahegelegenen Tumegl/Tomils, deren Anfänge bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen, ist davon auszugehen, dass die Reliquienbehälter wie auch die Mensa, die ursprünglich zu einem Tischaltar gehörte, im Mittelalter von Sogn Murezi in die erste Kirche von Sogn Luregn (Bau 1) transloziert worden waren.
Spätestens seit dieser Erkenntnis bestand das Vorhaben, die Bauphasen von Sogn Luregn möglichst präzise zu datieren. Mangels schriftlicher Quellen kam hierfür einzig die Methode der Dendrochronologie infrage. Allfällige Holzreste im Innern der Kirche und an den Fassaden fehlten jedoch oder waren infolge der Restaurierungsarbeiten Sulsers überdeckt worden. Die Dachräume über dem Schiff und dem Chor von Sogn Luregn blieben, im Gegensatz zu den meisten anderen Kirchen, ohne Zugang. Erst 2023 bot sich die Gelegenheit für einen Einstieg, als die Dachhaut aus Holzschindeln am Schiff und am Chor, letztmals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erneuert, ersetzt werden musste. Nachdem der Schindelmacher Patrik Stäger, Untervaz, und seine Mitarbeiter die alten Schindeln entfernt hatten, konnten sich die Schreibenden zwischen der Lattung hindurch in die beiden Dachräume zwängen. Zuzüglich den Proben der Dachstühle von Schiff und Chor wurden auch die original ins Mauerwerk gesetzten Tragbalken zum ersten Geschossboden im Turm dendrochronologisch untersucht, um zu überprüfen, ob der Glockenturm an der Südseite tatsächlich gleichzeitig mit dem Chor errichtet worden war.
Von den insgesamt 24 Proben ergaben zehn eine dendrochronologische Datierung. Von Bau 1 konnten keine Proben gewonnen werden. Dem Bau 2 sind insgesamt sieben Daten zuzuweisen, wobei nicht mehr alle Balken in situ liegen, sondern teils in Bau 3 wiederverwendet worden sind (Abb. 1). Für die in Bau 3 wiederverwendeten Stammhölzer im Dachstuhl über dem Schiff (Streben) und die in Bau 2 original gesetzten Balken des Chordachstuhls – Binder, Firstpfette, Sparren und Lattung – liess sich mehrfach das übereinstimmende Fälldatum im Winterhalbjahr 1207/1208 ermitteln. Den Hölzern im Turm fehlten infolge der Bearbeitung und Verwitterung die äusseren Jahrringe bis zur Rinde. Die Kernholzdaten 1164 und 1176 der beiden datierten Balken lassen aber für die verarbeiteten Stämme Schlagdaten in der gleichen Zeit annehmen. Die Wiederherstellung der Kirche mit dem Neubau des Chores und des Turms ist damit zweifelsfrei ins Jahr 1208 datiert (Bau 2).
Die Wand der Giebelmauer von Bau 2, die zugleich die Trennmauer zum Chor bildet, trägt an der Seite zum Schiff einen sorgfältig aufgetragenen pietra rasa-Verputz, der zusätzlich mit Fugenstrich betont ist (Abb. 2). Die chorseitige Wand hingegen ist unverputzt belassen. Das gleiche Bild zeigt auch die innere Seite der westlichen Giebelmauer des Schiffs. Die Vermutung liegt nahe, dass der Dachstuhl über dem Schiff von Bau 2 offen und nur die von den Gläubigen ansichtige Giebelseite über dem Chorbogen aufwendiger gestaltet war.
Der bestehende Dachstuhl über dem Schiff ist anhand zweier Fälldaten von Binderbalken, die in das Mauerwerk von Bau 2 eingebrochen sind, im Jahr 1771 aufgerichtet worden. Die bestehende Flachdecke aus Holz dürfte zeitgleich eingebaut worden sein. Im Dachstuhl über dem Chor sind nach 1208 hingegen einzig Stützstreben und ein Spannbalken dazugesetzt worden.
In beiden Giebelmauern des Schiffs sind sorgfältig gerichtete Quader sowie Mauersteine mit anhaftendem Verputzstücken, zum Teil mit Bemalung, verbaut. Es ist zu vermuten, dass es sich dabei um wiederverwendetes Baumaterial der abgebrochenen Gebäudeteile von Bau 1 handelt.
Zum erhaltenen Bestand der ersten Kirche gehört auch das rundbogige Eingangsportal an der Südseite des Schiffs und die exakt darüber liegenden Blendarkaden von zwei Bögen (Abb. 3,1.2). Erwin Poeschel vermutete, dass diese Architekturelemente auf einen turmartigen Aufbau über den Südwestteil der Kirche Bezug nehmen könnten. Wahrscheinlicher erscheint es, dass auf der Südmauer des Schiffs über den Blendarkaden ein einfaches Glockenjoch stand. Nach dem Abbruch des Jochs 1208 wurde der Glockenturm, dessen Nordmauer auf der Schiffsmauer von Bau 1 steht, direkt davor errichtet.
An der Innenseite des Turms sind im Dachraum des Schiffs die Steinplatten eines schwach geneigten Satteldachs sichtbar (Abb. 3.3). Es dürfte sich dabei um Reste der Eindeckung des Quergiebels handeln, der den Raum zwischen dem Turm und dem Hauptgiebel über dem Schiff von Bau 2 überdachte. Die Neigungsrichtung dieses Quergiebels und damit die Höhe des Dachs von Bau 1 sind nicht zu rekonstruieren. Bei der Erneuerung im Jahr 1771 wurde dieser abgebrochen und durch das deutlich steilere Dach ersetzt.


 Tutte le cronache
Tutte le cronache