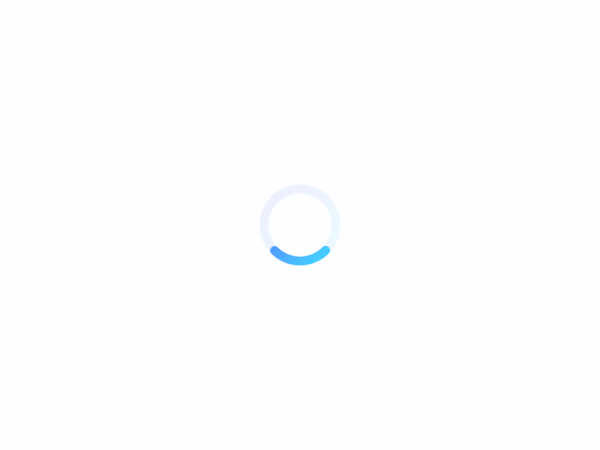Auf dem Buechholz-Plateau hoch über dem Aaretal befindet sich eines der eindrücklichsten prähistorischen Geländedenkmäler des Kantons Solothurn. Ein rund 600 m langer, bis zu 16 m breiter und 8 m hoher Wall schliesst das Plateau gegen Süden ab und umfasst so eine augenförmige Fläche von etwa 13 ha. Im Südwesten ist dem Wall ein 175 m langer, maximal 15 m breiter und 2.5 m tiefer Graben vorgelagert. Gegen das Aaretal im Norden und gegen das Roggenhusertäli im Osten bilden Felswände und Steilhänge einen natürlichen Schutz. Die bisher einzige Ausgrabung zu Beginn des 20. Jhs. fokussierte auf die Untersuchung der Wallanlage. Die spärlichen Funde legen eine grobe Datierung in die Jüngere Eisenzeit nahe.
Anstoss für die aktuelle Prospektion war die Erarbeitung einer Informationstafel durch die Firma ProSpect GmbH, Aarau. Im Auftrag der Kantonsarchäologie führte ProSpect in Zusammenarbeit mit URMO, Altdorf, von März bis September 2024 eine Prospektion durch. Dabei wurde das gesamte Plateau in mehreren Durchgängen nach Metallfunden und anderen Objekten abgesucht. Insgesamt wurden 94 oberflächennahe Fundobjekte geborgen, darunter mindestens 15 spätlatènezeitliche Münzen. Bei den übrigen Objekten handelt es sich um neuzeitliche Geräte und Nägel oder solche, die sich zeitlich nicht einordnen lassen. Zusammen mit einer früheren Prospektion aus dem Jahr 2010, die sieben Münzen zu Tage förderte, liegen nun insgesamt 22 Münzen aus der Spätlatènezeit vor. Diese verteilen sich über einen Grossteil der Innenfläche. Einzelne Münzen kamen westlich des Grabens, ausserhalb der Anlage, zum Vorschein. Da man während beider Prospektionen Raublöcher entdeckte, ist damit zu rechnen, dass bereits früher illegal Metallobjekte entwendet wurden, und somit wohl auch eine unbekannte Anzahl an Münzen im Gesamtbild fehlen. Die Münzfunde belegen, dass das Plateau in der Spätlatènezeit besiedelt oder zumindest begangen wurde.
Um die Datierung des Walls noch einmal zu überprüfen, wurde ein Unterkieferknochen eines Rindes, der bei der Ausgrabung Anfang des 20. Jh. aus dem oberen Teil des Walls geborgen worden war, mittels der 14C-Methode analysiert. Diese Messung ergab eine sehr wahrscheinliche Datierung in den Zeitraum zwischen 200 und 50 v. Chr., was gut zur zeitlichen Einordnung der Fundmünzen passt. Ob die Befestigung tatsächlich in der Spätlatènezeit errichtet wurde, oder ob sie damals nur erhöht wurde und ihr Ursprung vielleicht sogar noch älter ist, muss vorerst offen bleiben.


 Tutte le cronache
Tutte le cronache