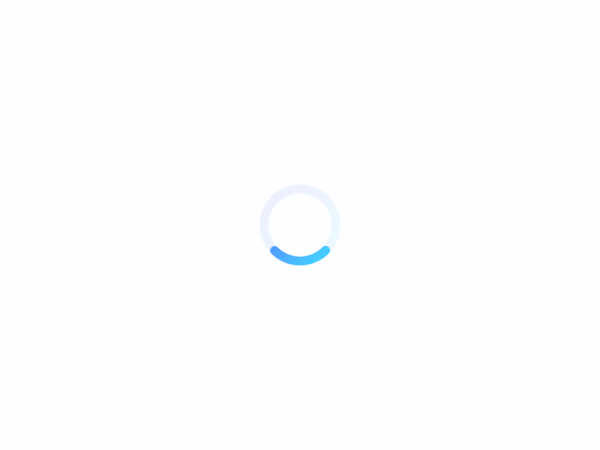Das geplante Überbauungsprojekt der Pensionskasse Graubünden auf der Parzelle 2733 nördlich des Markthallenplatzes in Chur sieht einen erheblichen Bodeneingriff in die Archäologiezone Welschdörfli vor. Da die letzten grossflächigen Ausgrabungskampagnen in den 1980er Jahren stattfanden, bot sich mit dem Neubauprojekt erstmals wieder die Gelegenheit einer umfassenden Flächengrabung in unmittelbarer Nähe der bekannten römischen Siedlung. Bereits in den Jahren 2020 und 2021 erfolgten geophysikalische Messungen und archäologische Sondierungen auf der Parzelle. Im Norden des Areals fanden sich dabei Überreste einer neuzeitlichen Sägerei, im Süden hingegen ein humoses Schichtpaket mit römischen Funden sowie eine darunterliegende Steinpackung. Nach Konkretisierung des Bauprojekts, das einen Baubeginn im Herbst 2024 projektierte, führte der Archäologische Dienst Graubünden (ADG) zwischen März und August 2024 eine archäologische Ausgrabung durch.
Das untersuchte Areal befand sich im Einflussgebiet der Plessur. Während der Ausgrabung zeigte sich, dass das Gebiet in der Vergangenheit wiederholt überschwemmt wurde. Am deutlichsten zeichnete sich das grosse Überschwemmungsereignis von 1762 ab, das ausgedehnte Bereiche entlang der Plessur überflutete. Auf der gesamten Fläche konnte ein 30 cm mächtiges Schwemmsediment über den archäologischen Schichten festgestellt werden, das diesem Ereignis zuordenbar ist. Im Süden des Ausgrabungsareals wurde ein als ehemaliger Bachlauf interpretierter Graben angeschnitten, welcher frühestens in römischer Zeit mit Sedimenten und Steinen verfüllt worden ist. Südlich des eingedolten Obertorer Mühlbachs, der durch die Parzelle fliesst, konnte ein weiterer ehemaliger Bachlauf erfasst werden. Dieser wies eine natürliche Sedimentierung auf. Direkt darüber lagen dichte Steinpackungen, die als Bodenbefestigung zur Stabilisierung des Untergrunds eingebracht worden sind. Gemäss der Radiokarbondatierung eines Knochens ist diese Verbauung ins Hochmittelalter zu setzen (1027–1158 n. Chr.). In die gleiche Epoche datieren auch zwei mächtige Pfostengruben mit Steinverkeilung am Westrand der Grabung. In einem Fall waren noch Reste des Holzpfostens vorhanden, die in die Zeit zwischen das 11. und 13. Jahrhundert n. Chr. datiert werden konnten (1053–1267 n. Chr.). Zusammen mit weiteren auf gleicher Linie angelegten Gruben weisen sie auf einen grossen hochmittelalterlichen Pfostenbau hin.
Im Zentrum des Grabungsareals wurden fünf parallel süd-nord verlaufende Gräben nachgewiesen, je 40–45 cm breit und mindestens 20 cm tief, mit einem Abstand von ca. 1.8 bis 2 m. Die bis zu 14 m langen Gräben reichten bis auf den anstehenden Flussschotter und wiesen eine sehr leichte Neigung auf. Stratigrafisch sind sie jünger als die hochmittelalterliche Bodenbefestigung. Auffällig ist, dass die Gräben parallel zu den Parzellengrenzen aus dem 19. Jahrhundert verliefen (Stadtplan Peter Hemmi 1835) sowie annähernd quer zur alten Ausfallstrasse von Chur nach Domat/Ems, die im Süden der Fläche festgestellt wurde. Diese Strasse wies einen mehrphasigen Kieskoffer auf und wurde noch vor 1835 durch die neu errichtete sogenannte «italienische Strasse» ersetzt. Schlussendlich konnten im Norden weitere Bereiche der neuzeitlichen Sägerei (19./20. Jahrhundert) dokumentiert werden.
Der Fundniederschlag war umfangreich. Die meisten Funde stammen aus dem 1.–3. Jahrhundert n. Chr. Die Objekte datieren in die Spätantike, das Mittelalter oder die Neuzeit, während eindeutige Funde aus der vorrömischen Zeit fehlen.
Trotz des hohen römischen Fundanteils fehlen dazugehörige Gebäudegrundrisse. Das Areal dürfte ausserhalb der Wohnzone gelegen haben. Es ist durchaus denkbar, dass das Gebiet in römischer Zeit zumindest gegen Norden eine aktive Flusslandschaft bildete und erst ab dem Hochmittelalter urbar gemacht wurde. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch ein Hochwasserereignis etwaige römische Strukturen und Schichten weggeschwemmt wurden.


 Toutes les chroniques
Toutes les chroniques