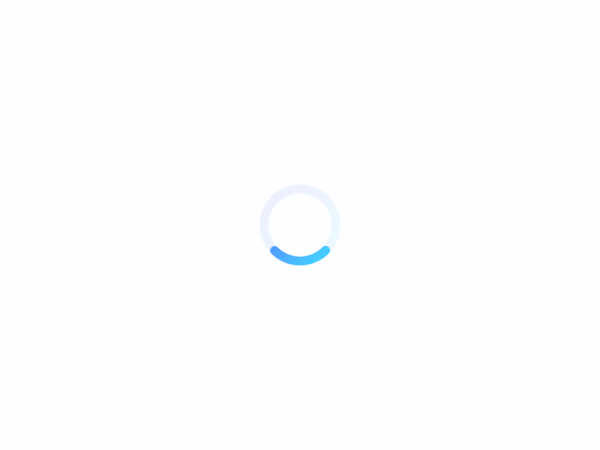Auenstein liegt am Jura-Südfuss direkt über der Aare. Eine ganze Serie von Ausgrabungen und Fundmeldungen zeigt inzwischen, dass im Bereich des heutigen Orts in der Mittel- und Spätbronzezeit durchgehend gesiedelt wurde.
Am Westrand der historischen Bebauung bildete der Güpfgraben einen siedlungs- und erhaltungsgünstigen Schwemmfächer aus. Hier wurde 2024 zum dritten Mal ein alter Oberboden mit bronzezeitlichen Funden und Befunden erfasst. Nachdem 2011 eine spätbronzezeitliche Brandgrube und ein mittelbronzezeitliches Kolluvium in einem Baugruben-Profil entdeckt wurden, waren es 2022 etwas hangaufwärts mittelbronzezeitliche Abfallschichten in einem ehemaligen Bachlauf.
2024 begleitete die KAAG die Aushubarbeiten für zwei Mehrfamilienhäuser am Westrand des Schwemmfächers. Dieser liegt im südost-orientierten Unterhangbereich eines mit Schotter bedeckten Jura-Rückens, der hier zur Aare hin abfällt. Diese Geländesituation liess eine Verzahnung von fluviatilen und kolluvialen Erosions- bzw. Sedimentationsprozessen erwarten. Tatsächlich zeigte sich, dass der südliche Teil des Aushubperimeters bereits flächig von Erosion betroffen war. Dort fanden sich über dem eiszeitlichen Schotter nur mittelalterliche und jüngere Kolluvien. Im Norden war das Gelände zwar von einzelnen Rinnen durchzogen, dazwischen war aber grossflächig noch das nacheiszeitliche Niveau samt altem Oberboden erhalten. Zahlreiche Funde – Keramik und vor allem Hitzesteine – markierten sogar noch den bronzezeitlichen Laufhorizont auf dem alten Oberboden.
Archäologische Befunde zeichneten sich meist erst im gewachsenen Unterboden ab. Zu nennen ist ein Hausstandort, an dem wahrscheinlich nacheinander zwei kleine Pfostenbauten (ca. 7.5 x 4.5 bzw. 6.5 x 4 m) standen. Mehrere diffuse Verfärbungen, die wenige stark fragmentierte Funde enthielten, dürften bronzezeitliche Aktivitätsbereiche anzeigen. Sie lagen beiderseits einer ca. 1.5 m breiten und am Nordwestrand der Untersuchungsfläche auf 4–5 m Länge erfassten Struktur, die partiell mit einer Steinpackung bedeckt war Unklar blieb, ob es sich um eine verfüllte Geländerinne oder um den Abschnitt einer Piste handelte, die im Bereich einer flachen Geländestufe ausgebessert worden war.
Hervorzuheben sind zwei Gruben, die nördlich der Hausgrundrisse im Abstand von etwa 5 m zueinander lagen. Ursprünglich waren sie rund 1.5 x 1 m bzw. 2 x 1.5 m gross und ca. 0.3 bis 0.5 m tief. Beide enthielten dichte Packungen aus überwiegend verbrannter Keramik und Steinen. In der einen Grube waren zwei Scherben- bzw. Fundschichten durch eine dünne Lehmschicht voneinander getrennt, in der anderen war nur eine Scherbenlage zu erkennen. In beiden Gruben scheint das Einbringen der Funde jeweils rasch und von einer Seite her erfolgt zu sein. Es handelt sich um rituelle Deponierungen von verbrannter Keramik, wie sie vor allem aus der Mittelbronzezeit und beginnenden Spätbronzezeit (BzC-BzD) von vielen Orten bekannt sind. Die Inventare aus Auenstein umfassen Fragmente zahlreicher Gefässe, die in die frühe Spätbronzezeit (Bz D2/HaA1) datieren. Keramikensembles aus diesem Zeitabschnitt sind im Aargau und allgemein in der Schweiz vergleichsweise selten.
Als deutlich älter erwies sich ein weiterer Befund. Es handelt sich um eine an der Oberfläche 1 x 1.7 m grosse und noch ca. 1.2 m tiefe Grube. Sie enthielt keinerlei archäologisch datierbares Fundmaterial. Ihr Y-förmiger Querschnitt ist allerdings typisch für sogenannte "Schlitzgruben" oder "fosses à profil en Y", die ausserhalb der Schweiz regelhaft im Umfeld neolithischer Siedlungen gefunden werden. Auf ein vor-bronzezeitliches Alter wies auch die auffallend starke Bioturbation hin. Die Bestätigung lieferten schliesslich zwei 14C-Datierungen an Holzkohlefragmenten: 4524±76 BP (BE-24124.1.1) und 4941±71 BP (BE-24125.1.1). Damit ist eine Datierung ins 4. Jahrtausend v. Chr. gesichert und eine Datierung in die Horgener Kultur bzw. die 2. Hälfte des 4. Jt. v. Chr. wahrscheinlich.


 All chronicles
All chronicles