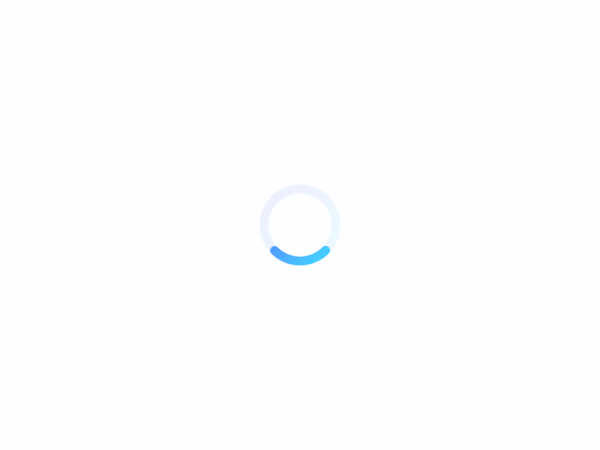Auslöser für die archäologischen Interventionen bei der Klosterkirche Hauterive (Gemeinde Posieux) war der Einbau einer Heizungsanlage. Gleichzeitig fanden umfangreiche Renovierungsarbeiten statt. Mehrere Restauratorenteams und Archäologen arbeiten hier seit 2021 zusammen. Sinnvollerweise sieht das Projekt auch das aussenseitige Isolieren der Gewölbe zur Kirche mit all ihren Elementen und jenen der angrenzenden Kapelle vor. Im Vorfeld dieser Isolierarbeiten wurden diese Bereiche vom Bauschutt befreit und grob gereinigt. Für die Bauforschung ist dies eine nicht wiederkehrende Gelegenheit, Dachstöcke und Dachwerke zu inspizieren.
Mehrere Publikationen widmen sich, aus verschiedenen Blickwinkeln, der Genese der Abtei, deren kanonische Gründung auf das Jahr 1138 zurückgeht. Es sind Zisterzienser, die sich in ländlicher und abgeschiedener Umgebung hier in einer Saaneschlaufe niederlassen. Zu den ersten provisorischen Bauten gibt es bisher keine Spuren. Zu den Steinbauten ab der ersten romanischen Bauetappe (1150-1160) sind 15 Phasen bis in 19.Jh. allein in den Dachgeschossen zu beobachten. Gut erkennbar sind auch zwei Brände, wovon der erste, gemäss Schriftquellen, 1578 verheerend gewesen sein muss. Es gibt keine Dachelemente im untersuchten Bereich, die nach aktueller Hypothese den Brand überdauert haben. Im Grossen und Ganzen lassen sich die Beobachtungen gut mit historischen Quellen und Literatur in Einklang bringen. Es ist hervorzuheben, dass es zu gegebener Zeit eindeutig zwei Steintürme über dem Mittelschiff gab. Einer an der Stelle, wo ein Neubau über dem originalen Sockel noch heute steht. Und ein zweiter Turm befand sich über dem Westportal (Abb. 1) Beide Fundamente sind identisch in Ausführung und Dimension. Dabei sind sie derart massiv, dass sie nur für gewichtige Steintürme Sinn ergeben. Eine Holzkonstruktion hätte man problemlos ohne Steinsockel über dem Gewölbe, direkt auf die Aussenmauern abstützen können. Überliefert ist, dass eine Ordensvisitation 1486 ein «Ausfransen» der Ordensregeln, mit an sich strenger Ausrichtung auf Arbeit und Gebet, festgestellt hat. Steinglockentürme wurden schon 1157 verboten. Vielleicht wurden die Steintürme im Anschluss an eben diese Visitation abgebrochen und nur durch jenen über der Vierung, als Holzbau, ersetzt.
Bemerkenswert sind auch zwei sekundär im Stuhl über dem Querschiff verbaute, gegen 9.5 Meter lange Deckenbalken mit Nut für eine Einschubdecke. Sie sind rot getüncht und mit weissen Schablonenmalereien verziert, die eine grobe Einordnung ins 16. Jh. ermöglichen. Stammen die schmucken Balken vielleicht aus dem Refektorium dieser Zeit?
Schliesslich ist noch ein Durchgang vom Dachstock des nördlichen Seitschiffs hin zum Dachstock des Mittelschiffs, als weitere Spezialität, zu beleuchten. Einen ersten Aufgang gab es schon in der romanischen Disposition. Die Treppe aus dieser Zeit wurde aber abgeschrotet und wich einer anderen Konstruktion. Auch der Zugang vom Mittelschiff her wurde mehrmals verändert. Der klar sekundär angelegte Zugang durch den Sockel des ehemaligen Westturms ist immer noch sichtbar. Es ist offensichtlich, dass dieser Zugang vom Schiff über das Seitenschiff zum Dachraum über dem Schiff, während langer Zeit eine wichtige Funktion gehabt haben muss. Welchen?
Eine genaue Auswertung mit Zuhilfenahme von absoluten Daten und zusammen mit der Dokumentation die Anfang des 20. Jhs im Zuge der ersten grossen Renovierung gemacht wurde, wird ein genaueres Bild der Bauabläufe liefern.


 All chronicles
All chronicles