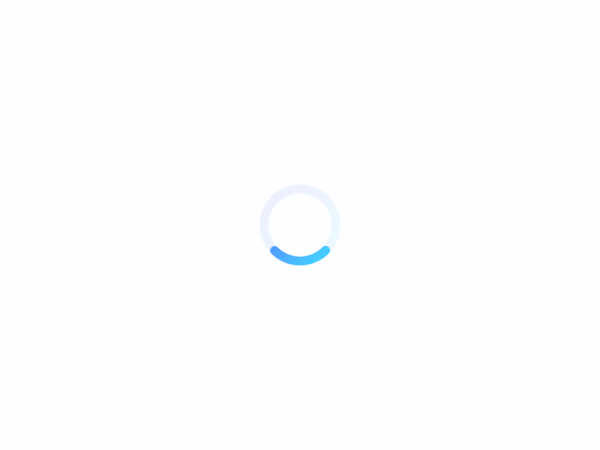Der bewaldete Schanzhübel in Besenbüren liegt nordwestlich des Dorfes. Es handelt sich um einen Moränenrücken, dessen Nord- und Südflanken steil abfallen. Nur gegen Westen läuft das Gelände flacher aus. Diese gut zugängliche Seite wurde durch einen 30 m langen Frontwall abgesichert. Der Wall ist an seiner höchsten Stelle noch rund 3 m hoch. Gegen Süden wird er niedriger und geht in einen noch ca. 1 m hohen, den ganzen Sporn umfassenden Randwall über. Die umfriedete Fläche misst 135 auf 30 m (4745 m2). Die Zeitstellung der Anlage war bislang unklar.
Für den Bau des Frontwalls wurde das Terrain vorgängig abhumusiert. Anschliessend wurde der Wallkörper mit lokalem Moränenmaterial vom Aushub des dahinterliegenden Grabens angeschüttet. Der Wallaufbau ist, soweit sich dies beurteilen lässt, einphasig. Dieses ungewöhnliche Vorgehen, auf der Innenseite des Walls einen Graben auszuheben, erleichterte das Aufschütten des Walls an der leicht abfallenden Böschung, schmälerte aber die Verteidigungsfunktion. Vermutlich stand auf der Innenseite des Grabens ein zweiter Frontwall. Dieser Bereich ist aber modern durch die Anlage eines Wasser-Reservoirs stark überprägt.
Eine Geröllschüttung und eine Ansammlung von grossen Steinen am äusseren Wallfuss sind als konstruktives Element anzusprechen, vermutlich dienten sie der Entwässerung. Die Wallkuppe ist von einer etwa 30 cm tiefen Bodenbildung überprägt, was auf ein Mindestalter von einigen hundert Jahren schliessen lässt. Der Umfassungswall zeigte im Schnitt einen ähnlichen Aufbau. In den Sondierschnitten im Innern der Anlage wurden diffuse Kulturschichten beobachtet, aus denen das spärliche Fundmaterial stammt (prähistorische Keramik, Knochenfragmente).
Die wenigen Keramikfunde sowie 14C-Daten von Holzkohlen aus dem Oberboden unter dem Wall (BE-24172: 2911±22 BP, BE-24175: 2886±22 BP und BE-24173: 2735±22 BP) und einem Knochenfragment (BE-24169: 2474±27 BP) belegen eine spätbronzezeitliche und hallstattzeitliche Nutzung des Platzes (ca. 1200 bis 800/450 v.Chr.). Der Wall selbst liess sich archäologisch nicht datieren und die beiden analysierten Holzkohlen aus der Wallschüttung sind wohl umgelagert und stammen ebenfalls aus der Spätbronze- und Hallstattzeit (BE-24171: 2717±21 BP und BE-24170: 2405±74 BP). Dennoch kann aufgrund bodenkundlicher Beobachtungen, der Bauweise und der Erhaltung der Befestigung von einer mittelalterlichen Zeitstellung ausgegangen werden. Dazu passt ein mittelalterliches 14C-Datum aus dem Innern der Anlage (BE-24174: 952±20 BP), das ca. Mitte 11. bis Mitte 12. Jh. datiert.


 All chronicles
All chronicles