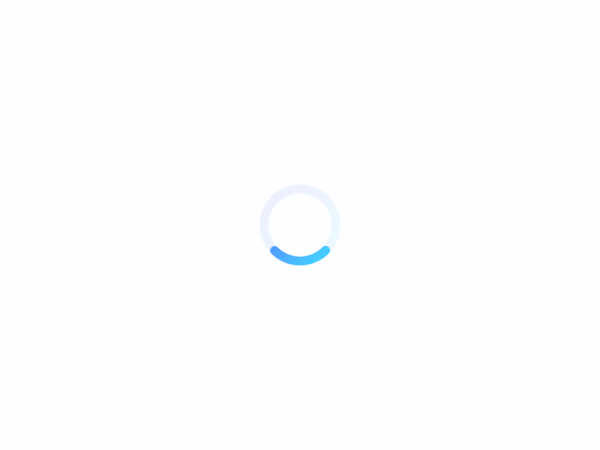Bei den Ausgrabungen durch den Archäologischen Dienst Graubünden in den Jahren 2016 und 2017 konnten im Fundamentbereich der 1491/1492 erbauten Kirche San Peter die Mauerreste der Vorgängerin, eines Nord-Süd orientierten, vorromanischen Baus von rechteckigem Grundriss, dokumentiert werden. Das Alter dieser Kirche liess sich mangels typologisch eindeutiger Merkmale oder durch Funde nicht bestimmen. Urkundlich erwähnt wird die Kirche San Peter erstmals im Jahr 1139. Aus romanischer Zeit steht noch der Campanile, an den die Westmauer des gotischen Kirchenschiffes lehnt. An der gleichen Stelle verlief auch die Westmauer des vorromanischen Baus. Leider konnte 2016/2017 die Abfolge des Turms und dieser ersten Kirche nicht geklärt werden. Unter dem Turmfundament wurde indes eine Bestattung freigelegt, deren Ausrichtung sich an der Westmauer des vorromanischen Baus orientiert. Dies kann als ein Indiz dafür gewertet werden, dass der Turm erst nachträglich an den ersten Kirchenbau gesetzt worden war. Die Bergung der erwähnten Bestattung unterblieb, weshalb es nicht möglich war, anhand einer 14C-Datierung der Knochen einen terminus ante quem für das Alter des vorromanischen Baus zu ermitteln.
Den Turm datierte Erwin Poeschel anhand typologischer Merkmale in die Zeit um 1100. Die Möglichkeit für eine dendrochronologische Untersuchung der bauzeitlichen Hölzer des Campanile ergab sich 2023, als eine Metallleiter mit dazugehöriger Absturzsicherung eingebaut worden und damit ein gefahrloser Aufstieg im über 20 m hohen Turm gewährleistet war.
Als Träger der Bretterböden sind in den Geschossen 1–5 jeweils zwei Balken eingebaut. Im sechsten Geschoss trägt ein Kranz von vier Balken nicht nur den Boden, sondern auch die in den Ecken aufgesetzten, bis über die Mauerkrone des 7. Geschosses reichenden Pfosten, die untereinander verstrebt sind und den Stuhl des ersten Geläuts trugen (Abb. 1). Aus der Bauzeit des Turms sind zudem die Gerüsthölzer, im Durchschnitt etwa 10–15 cm starke Rundhölzer, erhalten, die im Mauerwerk verankert wurden und innen und aussen vorkragend die aufgelegten Gerüstläufe für die Maurer trugen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sägte man sie ab, wovon heute noch deren Stümpfe zeugen. Der Holzaufbau mit Zeltdach umschliesst den Glockenstuhl, der gemäss der Jahrzahl auf der Glocke 1886 aufgesetzt worden war. Obwohl keine Darstellung der Kirche von vor 1886 existiert, ist davon auszugehen, dass der Turm ursprünglich ein mit Steinplatten gedecktes Pyramidendach trug, wie es bei romanischen Kirchtürmen üblich ist.
Die Serie der im Turm dendrochronologisch beprobten Hölzer setzt sich aus sieben Gerüsthölzern, neun Tragbalken von Geschossböden und zwei Balken des ursprünglichen Glockenstuhls zusammen. Sämtliche Bauhölzer sind aus Lärchenstämmen gefertigt. Die Synchronisation der Einzelholzkurven erwies sich als äusserst aufwendig, da die Hölzer extrem schmale Jahrringe (Breite <1/10 mm) aufweisen und zudem an verschiedenen Stellen fehlende Jahrringe, verursacht durch den Befall des Lärchenwicklers, eingesetzt werden mussten. Trotz aller Kontrollen und Nachmessungen ist es möglich, dass bei einzelnen Proben ausgefallene Jahrringe nicht erkannt wurden. Als schwierig erwiesen sich die Korrelationsarbeiten auch deshalb, weil für den Zeitraum des 10.–12. Jahrhunderts nur wenige Lärchenreferenzen aus dem Engadin zur Verfügung stehen und bei diesen ebenfalls vereinzelt Jahrringe fehlen können. Dennoch konnte ein beträchtlicher Teil der Hölzer des Turms von San Peter zweifelsfrei synchronisiert, datiert und damit dessen Bauzeit bestimmt werden.
Die aus den Jahrringwerten von neun Tragbalken und Gerüsthölzern erstellte, 230-jährige Sequenz lieferte auf verschiedenen regionalen und lokalen Jahrringkurven übereinstimmend das Endjahrdatum 1105. Die beste Synchronlage zeigt die Mittelsequenz auf der Lokalkurve, die für Balken in der Kirche San Romerio bei Brusio erarbeitet wurde. Für den Turm von San Peter liegt lediglich ein sicheres Fälljahr im Herbst/Winter des Jahres 1105(/1106) vor. Drei Waldkanten, die aufgrund der starken Verwitterung der originalen Stammoberflächen und/oder wegen der extremen Engringigkeit der äusseren Jahrringe als unsicher gewertet wurden, fügen sich mit den Endjahren 1105 (Tragbalken) und 1102 (einmal Tragbalken, einmal Gerüstholz) plausibel ein. Weiter sind unsichere Waldkanten mit den Endjahren 1066, 1084 und 1082 (Tragbalken) und 1061 und 1048 (Gerüsthölzer) vorhanden. Der Ähnlichkeit im Kurvenverlauf nach zu urteilen dürften die Proben 1 und 2 (Tragbalken) von demselben Baum stammen, sodass auch für die Probe 2 das unsichere Fälljahr 1066 angenommen werden kann. Bei Gerüsthölzern konnte bereits an anderen Bauten, insbesondere Burgen, festgestellt werden, dass deren Schlagdaten einige Jahre von der Bauzeit abweichen können. Bei Tragbalken ist dies eher ungewöhnlich. Unter Berücksichtigung der geringen Tragbalkenlänge von etwa 1–1.30 m spricht jedoch aus bauarchäologischer Sicht nichts gegen die sekundäre Verwendung von Balken oder die Verbauung von Altholz. Durch die ermittelten Fälldaten der verarbeiteten Stämme ist die Bauzeit des Turms ins Frühjahr oder den Sommer 1106 oder kurz danach festgelegt. Damit ist auch die von Erwin Poeschel anhand typologischer Vergleiche geäusserte Vermutung des Datums um 1100 bestätigt.
Nicht datiert werden konnten bisher die beiden Balken 17 und 18 des ursprünglichen Glockenstuhls, obwohl dieser zeitgleich mit dem Bau des Turmes zu datieren ist. Möglicherweise konnten die Jahrringkurven der beiden Balken 17 und 18 nicht mit den anderen Balken in Synchronlage gebracht werden, weil deren Jahrringkurven von geringer Länge sind und sie, im Gegensatz zu den datierten Hölzern, keine klaren Marker in Form von Jahrringbreitenreduktionen durch Lärchenwicklerbefall aufweisen.
Bei näherer Betrachtung der Turmfassaden konnte im obersten Geschoss und am Gesims eine partiell noch erhaltene Quadrierung mit weisser Tünche festgestellt werden (Abb. 2). Horizontal und vertikal angebrachte Fugenritzung (Fugenstrich) ist an allen Fassaden erhalten, vermutlich war diese auf allen Turmseiten weiss ausgezeichnet, um den Anschein von Quadermauerwerk zu erwecken. Der Mauerbereich unterhalb des Kranzgesims war besser vor der Witterung geschützt als die tiefer liegenden Fassadenflächen, weshalb sich hier die bauzeitliche, weisse Quadrierung erhalten hat. Das nächste Vergleichsbeispiel einer Betonung von Architekturelementen mit weiss gefärbtem Fugenputz ist im Kloster St. Johann in Müstair zu finden. Es handelt sich um die Bogensteine des ursprünglichen Portals zur 1035 datierten Ulrichskapelle im Norperttrakt.


 All chronicles
All chronicles